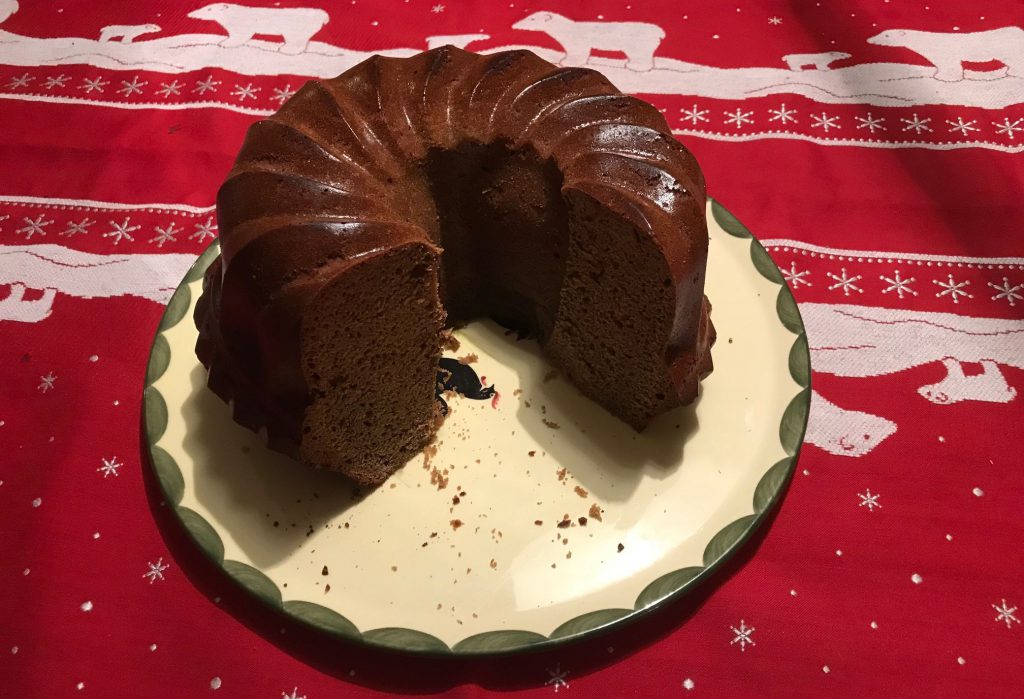Gestern um diese Zeit haben wir davon erfahren: Notre Dame steht in Flammen. Noch bevor ich die Bilder vom Brand gesehen habe, waren da andere Bilder in meinem Kopf, in meinem Herzen. Erstaunlich viele Bilder. Und je länger ich darüber nachdachte, warum mich die Nachricht so traurig machte, umso mehr Erinnerungen kamen mir.
In Notre Dame habe ich Zuflucht gesucht als ich während eines Praktikums vom Tod eines guten Bekannten in der Heimat erfuhr.
In Notre Dame habe ich mit einer Freundin ein Orgelkonzert gehört, das mit „freiem Eintritt“ warb und bei dem man am Ausgang von den Wärtern mehr als unfreundlich gebeten wurde, etwas zu spenden – mit Angabe von Summen, die die Organisatoren sich dabei gedacht hatten. Etwas geben wollten wir gerne – aber so viel, das war für uns Studentinnen nicht möglich. Und so stellte ich fest, dass ich in der gar nicht mehr ganz so neuen Sprache durchaus erfolgreich Streitgespräche führen konnte.
An einem Palmsonntag wollte ich gerne den bekannten Kardinal Lustiger in Notre Dame erleben. Doch schon bei der Palmprozession auf dem Vorplatz sah ich, dass da noch ein Kardinal war. Von meinem Sitzplatz in der Kirche konnte ich dank einer Säule den Zelebranten nicht sehen, doch die Stimme und den Akzent erkannte ich direkt, auch ohne dass der Herr neben mir erfurchtsvoll in die Runde flüsterte, „oh, le cardinal Ratzinger“. Ich überlegte, ob ich wieder gehen sollte (ein Fan war ich noch nie), und dachte dann, dass er es ja ebenso mit mir unter diesem Dach aushalten müsse wie ich mit ihm.
Die kürzeste Eucharistiefeier meines Lebens habe ich in Notre Dame erlebt, 23 Minuten (mit Chor). Und während wir Gläubigen noch zur Kommunion gingen, hatte der Priester die Messe schon zu Ende gelesen und war im Eilschritt davongelaufen, die Messdiener ungeordnet hinterherstolpernd.
Während der Abendgottesdienste werden die Besichtigungen fortgesetzt. Ich habe mich in Notre Dame nicht nur einmal wie ein Tier im Zoo gefühlt. Katholikin, seltenes Exemplar, vom Aussterben bedroht, bitte nicht füttern.
Staunend habe ich den Blick erhoben zu den Rosetten und mich am wechselnden Farbspiel der Fenster erfreut. Ich konnte mich nicht satt sehen an den langen, eleganten Säulen und dem hohen Dach. Hand in Hand mit dem Lieblingsmenschen ging ich durch den Chorumgang und bewunderte die Strebepfeiler des Chores.
Wie oft fuhr ich mit der Metro von der Gare de l’Est und später von der Gare du Nord zur Gare de Montparnasse und wann immer ich genug Zeit zum Umsteigen hatte, stieg ich an der Haltestelle Cité aus, um einen Blick auf die Seine und die gotische Schönheit zu werfen.
Mit meiner besten Freundin saß ich stundenlang auf einem Mäuerchen mit Blick auf die Zwillingstürme und redete über Gott und die Welt. Mit einem guten Freund trank ich einige Tage später einen überraschend guten Wein in einem Bistro um die Ecke. Und natürlich hatte ich meinen zerlesenen Victor Hugo in der Handtasche, um darin zu lesen, falls er sich verspätete.
In einem kleinen Antiquitätenladen um die Ecke kauften der Lieblingsmensch und ich zwei Trinkgläser, die wir bis heute nicht nur, aber immer zu besonderen Anlässen nutzen.
Ich mochte das Abendlicht und das Licht der tief stehenden Novembersonne auf ihren Außenmauern – was war ich oft im November in Paris.
Ich schaute schnell zu ihr hinüber, wenn ich zur Sainte-Chapelle ging, die ich lange so sehr gerne hatte, und ich hatte ihr Bild vor Augen, als ich Stefan Zweigs Marie Antoinette vor einigen Jahren wieder las, liegt doch die Concièrgerie gleich um die Ecke.
Noch am Freitag gab ich einer Freundin, die bald zum ersten Mal nach Paris fährt, Tipps und natürlich durfte Notre Dame nicht fehlen.
Die große Kirche mit ihrer Wucht und ihrem Pomp, ihrer beeindruckenden Größe und ihrer wunderbaren Helligkeit war nie mein Lieblingsort in Paris. Und doch hat sie sich mit den Jahren in mein Herz geschlichen. Und dort wird sie bleiben, egal, wie lange der Wiederaufbau dauern wird.