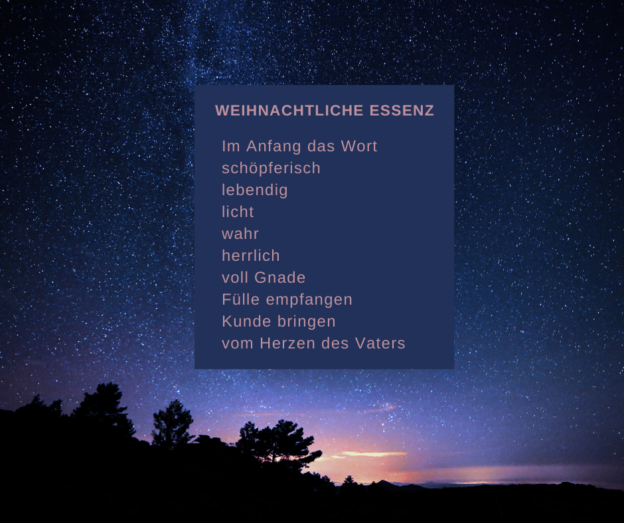Manchmal weiß man es ja erst später, irgendwann, danach, wenn man zurücksieht oder jemand einen darauf aufmerksam macht, dass etwas, was man erlebt hat, ein historischer Moment war. Ich habe gerade das Privileg, an etwas teilhaben zu dürfen, von dem bereits jetzt klar ist, dass da Geschichte geschrieben wird. Geschicht mit einem ganz großen G. Frauengeschichte. Kirchengeschichte. Und in gewisser Weise auch eine Liebesgeschichte.
Ich teile hier einige Wochen mit Frauen, Ordensfrauen, die nicht den einfachen Weg wählen. Die miteinander und mit dem HERRN ringen um den richtigen Weg. Auch wenn das ein schmerzhafter Weg ist, auf dem einige von ihnen etwas hergeben, aufgeben, hinter sich lassen werden, das ihnen sehr am Herzen liegt. Und auf dem andere sich auf Neues einstellen, sich für Ungewohntes öffnen und Unsicherheiten aushalten werden müssen. Ein Weg, bei dem von vornherein klar ist, dass er eher steil, holprig und schwierig werden wird. Einer, auf dem niemand rosarote Brillen anreicht und Tränen vorprogrammiert sind – auch wenn er mit Freudentränen (vielen davon) beginnt. Auch in solchen Liebesgeschichten gibt es nämlich Liebeskummer. Denn auch wenn sie kein Eheversprechen abgelegt haben, wissen diese Frauen um diese Sache mit den guten und den weniger guten und auch den richtig schlechten Tagen.
Und trotzdem.
Trotzdem ducken sie sich nicht weg, laufen sie nicht davon. Es steht nirgendwo geschrieben, das sie sich dem aussetzen müssen, niemand zwingt sie dazu, ihr „weiter wie bisher“ aufzugeben – denn das „weiter so“ ist ja nicht schlecht, sie würden ja mit etwas Gutem weitermachen, mit vielen kleinen individuellen Einsätzen für Menschen und auch einem umfassenderen Guten. Trotzdem.
Trotzdem tun sie das, was sie als richtig erkannt haben. Ringen um Klarheit und Vertrauen, um Mut und Verständnis. Sie hören einander zu – auch das auf eine Art und Weise, die andernorts nicht selbstverständlich ist. Sie hören mit den Ohren, aber auch mit den Augen und dem Herzen. Sie scheuen den Konflikt nicht, klammern die wunden Punkte nicht aus. Sprechen offen über das, was drückt, über die „Steine im Schuh“, die sie am Vorankommen hindern, die scheuern, die Haut aufreiben, auch die auf der Seele.
Sie singen und tanzen miteinander, ausgelassen und mit ganzem Herzen. Und dann geben sie sich, einzeln und als Gruppe, den Prozess und die Menschen, für die ihre Schritte eine Auswirkung haben werden, in die Hand eines Größeren. Schweigen. Beten. Lassen sich neue Perspektiven öffnen, sich verwandeln, stärken. So werden Entscheidungen möglich, die ich von meiner Position etwas weiter außen erhofft haben mag, von denen ich aber trotzdem bewegt bin ob ihres Tempos, ihrer Klarheit und Entschlossenheit.
Ich bin sehr berührt – nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von dieser Art des ehrlichen Ringens, der Ernsthaftigkeit der Suche und der Fröhlichkeit des Beieinanderseins. Ich schaue auf das Bild Mary Wards, das auf meinem Schreibtisch steht und deren Vorbild diese Schwestern folgen, einer mutigen, tatkräftigen, visionären Frau zu Beginn des 17. Jahrhunderts. „Women in time to come will do much“, war sie schon vor mehr als 400 Jahren überzeugt. Eine dieser Zeiten ist jetzt.