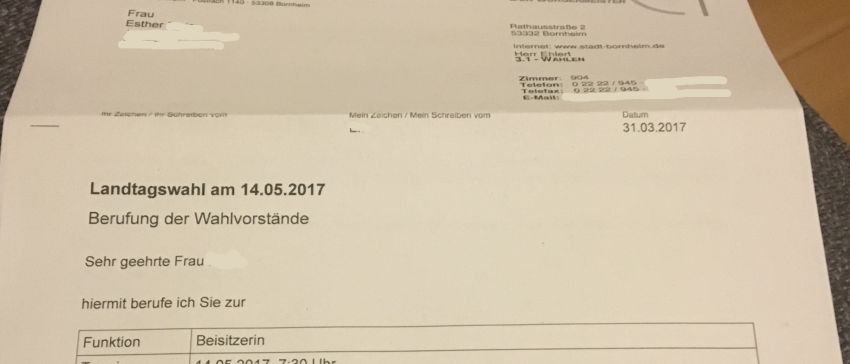Am Sonntag wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. Beziehungsweise bestimmen sie, wer es in den zweiten Wahlgang schafft und dann Präsidentin oder Präsident werden kann. Und je mehr ich von Freunden und Bekannten höre und in deutschen und französischen Medien lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das Land, das ich liebe, sich grundlegender verändert hat, als ich es bisher wahrhaben wollte.
Meine Liebe zu Frankreich ist irgendwie einfach so entstanden. Ich bin in der Nähe der Grenze groß geworden und habe schon in der Grundschule die ersten französischen Vokabeln gelernt. Ganz selbstverständlich wollte ich unbedingt Französisch als erste Fremdsprache lernen. Und selbst wenn der erste Schüleraustausch in der sechsten Klasse ein kompletter Reinfall war (meine einige Jahre ältere Austauschpartnerin war zum ersten Mal verliebt und verbrachte ihre gesamte Freizeit mit ihrem Freund, während ich allein auf einem kleinen Dorf ohne andere Jugendliche festsaß und mit „bébé“ spielen konnte, dem dreijährigen Nachzüglerkind der Familie, das von allen so babyhaft behandelt wurde, dass es weder sprechen noch sicher laufen konnte oder wollte), habe ich mich unmerklich nach und nach unsterblich in dieses Land, seine Menschen, seine Sprache verliebt.
Außerhalb der Ferien radelten wir mit Freundinnen ins Elsass, kauften Baguette und Käse, und picknickten am Rheinufer – stilecht auf der französischen Seite.
Im Sommer nach dem ersten Austauschversuch war ich wieder in Frankreich. Diesmal bei einer Familie mit einem gleichaltrigen Mädchen, einem kleinen Häuschen mit Garten in einer wundervollen Kleinstadt. In den folgenden Jahren trafen wir uns immer wieder, mal in Deutschland, mal in Frankreich, wir plauderten in unseren beiden Sprachen, spielten mit den Haushühnern in Frankreich und fuhren begeistert mit der Wildwasserbahn im benachbarten Freizeitpark, wenn wir in Deutschland waren. Meine französische Freundin verdrehte den Jungs in meiner Clique reihenweise den Kopf. Ich lernte flirten, und verknallte mich in Diderot und französische Popmusik.
Und dann war da diese Begegnung in meinem ersten Langres-Sommer. An einem langen Wochenendtag besuchten wir die Großeltern der Familie. Gegen Ende des unenedlich langen und unendlich gemütlichen Familienessens, stand der Großvater auf, ging in ein Nachbarzimmer und kam mit einem Buch und einer Dose in der Hand zurück. Er drückte mir lächelnd beides in die Hand und die kleine, frankreichliebende, familiendynamik beobachtende Austauschschülerin, die ich war, saß plötzlich sprach- und ratlos inmitten der Großfamilie. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen und wie ich die Situation einordnen sollte. Das Buch war „Mein Kampf“ und in der Dose steckten ein paar Reichsmarkscheine.
An die gespannten Blicke und die plötzliche, neugierige Stille am Tisch kann ich mich noch heute lebhaft erinnern. Und auch daran, dass es der Großvater war, der die Stille brach. Er war – neben meinem Vater – der erste Mensch, der mir von seinen Kriegserlebnissen erzählte. Davon, dass er in Deutschland in Kriegsgefangenschaft geraten war. Dass er als Knecht auf einem süddeutschen Bauernhof arbeiten musste. Und dass die Bauernfamilie sehr nett zu ihm gewesen sei. Er habe genug zu essen gehabt und mit viel Geduld habe der Familienvater ihm ein wenig Deutsch beigebracht. Er durfte die Bücher in der guten Stube lesen – oder versuchen, etwas daraus zu verstehen – und er durfte mit der Familie gemeinsam am Tisch sitzen.
Buch und Geldscheine bewahre er auf, um sich immer an diese Menschlichkeit mitten im Krieg zu erinnern. Er konnte sogar noch immer einige Sätze auf deutsch sagen. Eine seiner Töchter hatte seine Liebe zur deutschen Sprache inhaliert und war Deutschlehrerin geworden. Europa war in allen weiteren Gesprächen an diesem Nachmittag und Abend der einzige logische Weg für die Zukunft.
Egal, wie viel ich später lernte und las über deutsch-französische Geschichte: Eindrücklicher habe ich nur sehr selten gespürt, was diese so junge Freundschaft zwischen zwei Völkern bedeutet. Zum ersten Mal habe ich mich an diesem Tag nicht nur als Deutsche gefühlt, sondern als Europäerin. Ich habe es in diesen Stunden als Dreizehn- oder Vierzehnjährige nicht bewusst wahrgenommen, nicht begreifen können, aber ich habe es wohl damals schon gefühlt: Dass wir alle, jede und jeder einzelne von uns, etwas zu einer friedvollen, menschlichen, hoffnungsvollen Wirklichkeit beitragen können.
Wenn viele Franzosen jetzt ernsthaft über einen „Frexit“ nachdenken; wenn Menschen, die ich seit Jahren kenne und schätze, davon sprechen, wie sehr Europa die Freiheit Frankreichs bedrohe; wenn die allgegenwärtige Angst vor dem Terror dazu führt, dass der Wunsch nach der Einschränkung von Freiheiten auch bei Menschen, die ich als weltoffen und kreativ kennengelernt habe, zu Forderungen führt, die auch Gleichheit und Brüderlichkeit einschränken würden, so dass diese nur noch für einige bestimmte Gruppen der Gesellschaft gelten sollen; dann blicke ich über die Grenze, die für mich lange nur noch auf dem Papier bestand, und verstehe die Welt nicht mehr.
Ich weiß, dass man für Liebe nicht immer Verständnis braucht. Dass man jemanden auch dann lieben kann, wenn man ihn gerade gar nicht versteht. Und doch hoffe ich, dass sich am Sonntag, und beim zweiten Wahlgang in vierzehn Tagen, viele Franzosen einlassen auf dieses Experiment, das Europa heißt. Auch wenn – und gerade weil – es keine einfachen Antworten verspricht. Dafür aber Begegnungen, ohne die wir alle so viel ärmer wären.
Vive la France. Vive l’Europe. Vive l’amitié.